
- DAZ.online
- DAZ / AZ
- DAZ 16/2020
- Treiber oder Getriebene
Digitalisierung
Treiber oder Getriebene?
Wie sich Apotheken in die digitale Gesellschaft integrieren (sollten)
Für jede Branche, also auch für die Apotheken, muss immer wieder aufs Neue überlegt werden, welche digitalen Lösungen notwendig bzw. wünschenswert sind, wie sie in das bereits bestehende Umfeld integriert werden können und welche Konsequenzen sich daraus für Betriebsabläufe und den wirtschaftlichen Ertrag ergeben. Allerdings müssen diese Überlegungen immer vor dem Hintergrund der digitalen Gesamtentwicklung geführt und ständig reflektiert und angepasst werden. Das betrifft sowohl den gesetzlich-regulativen Rahmen, als auch die Entscheidungen aktueller oder potenzieller Kooperationspartner sowie die Bewertung digitaler Neuentwicklungen bezüglich der Auswirkungen auf die eigene Branche.
Forciert wird diese Entwicklung nicht zuletzt durch die Krankenkassen, die z. B. mit der Eigenentwicklung von elektronischen Patientenakten und Verordnungen Druck auf die gesundheitspolitischen Akteure ausgeübt haben. Sie sind es vor allem auch, die mit den Schlagworten der „digitalen Transformation“ und des „disruptiven Potenzials der Digitalisierung“ davor warnen, „dass die heute dominierenden (System-)Akteure ersetzt werden“ ohne dass sie benennen könnten, durch wen dies erfolgen soll [1]. In der Tat gibt es solche Ansätze bereits seit einiger Zeit. So hat, um nur ein Beispiel zu nennen, der Konzern Cisco auf dem EUREF-Campus in der Nähe des Schöneberger Gasometers in Berlin sein neues „Center of Connected Health“ aufgebaut, eine Mischung aus E-Health-Showroom, Innovationsschmiede, Schulungszentrum und Software-Lab. Herzstück des Digitalprojektes ist das Gesundheitsnetzwerk der AOK Nordost, an dem neben Cisco auch der IHE-Spezialist Tiani Spirit, der Technologiepartner xevIT und der Betreiber des Gesundheitsnetzwerks sigeso beteiligt sind, außerdem die Klinikkonzerne Vivantes und Sana. In Schöneberg hat Cisco eine Art Versorgungsparcours aufgebaut, mit Krankenhaus, Arztpraxis, Krankenkasse und dem Wohnzimmer des Patienten als Stationen, die über eine vernetzte Gesundheits- und Versorgungsakte verbunden werden. Notfallversorgung und Medikationsmanagement (!) sind zwei der in Berlin ausgearbeiteten Use Cases [2].
Apotheken gehörten zu den Vorreitern der Digitalisierung im Gesundheitswesen.
Aber auch die Versicherungsbranche drängt auf den Gesundheitsmarkt, z. B. die Allianz Partners mit Medi24 jetzt auch in Deutschland, die ihren Kunden medizinische Soforthilfe rund um die Uhr anbieten. Anrufer werden unter einer Hotline direkt mit medizinischem Fachpersonal verbunden, das die Situation des Anrufers bewertet und eine Handlungsempfehlung ausspricht, die bisher offenbar keine Arzneimittelverordnung beinhaltet. Der Service sei ab sofort verfügbar und in der Testphase kostenlos [2]. Dass derartige Modellprojekte das traditionelle Gesundheitssystem komplett ersetzen, ist indes auf kurze Sicht unwahrscheinlich. Allerdings sollten die dabei gewonnenen Erfahrungen für Anpassungsprozesse in den bestehenden Strukturen genutzt werden, und zwar ehe sich „innovative Anbieter“ auf dem Gesundheitsmarkt so etablieren, dass sie eine größere Marktmacht gewinnen. Denn digitale Transformation kann man auch auffassen als die Integration von neuen digitalen technischen Möglichkeiten in bekannte Markt- und Systemstrukturen.
Nutzeffekte durch Kooperation schaffen
Die Apotheken haben einst zu den Vorreitern der computergestützten Prozesssteuerung gehört, als sie die elektronisch unterstützte Warenbewirtschaftung einführten, die relativ schnell zum allgemein genutzten Standard wurde. Damit standen auch betriebsinterne Daten zur Verfügung, mit deren Hilfe man – wenn man wollte – die eigene Warenbewirtschaftung optimieren und Umsatzschwerpunkte erkennen konnte, die gleichzeitig auch für eine gezielte Beratung von Bedeutung waren.
Nicht zuletzt durch das Digitale-Versorgungsgesetz (DVG) und weitere bereits vorliegende Gesetzesentwürfe hat die digitale Aufrüstung des Gesundheitswesens eine bisher nicht gesehene Dynamik erlangt. Wenn Digitalisierung ihre potenziellen Nutzeffekte optimal entfalten soll, zwingt sie zur Kooperation innerhalb der Sektorengrenzen, aber auch darüber hinaus. Technisch lässt sich die Zusammenarbeit durch ein notwendiges Maß an Standardisierung und über entsprechende offene Schnittstellen schon seit Längerem umsetzen. Noch wichtiger sind aber inhaltliche Vereinbarungen, die die Kooperation regeln. Auch deshalb muss die weitere Digitalisierung, z. B. in den einzelnen Apotheken, in die Gesamtentwicklung aller Kooperationspartner eingebettet sein und wo nötig durch regulatorische Maßnahmen unterstützt werden.
Da eine gemeinsam erarbeitete Strategie bisher auf sich warten lässt, bedarf es einer kontinuierlichen Beobachtung und Diskussion der schrittweisen digitalen Umgestaltung der gesundheitlichen Versorgung, um möglichst langfristig tragfähige Entscheidungen treffen zu können. Wie komplex derartige Entwicklungen sind, soll an drei Beispielen kurz erläutert werden.
Nicht nur Belieferung – Das E-Rezept kann erst dann seinen vollen, digitalen Nutzen entfalten, wenn die Daten auch für Medikationschecks eingesetzt werden können.
1. Das elektronische Rezept
Die Entwicklung von Apps für das elektronische Rezept, die gleich von mehreren Anbietern in Angriff genommen wurde, erinnern eher an ein Wettrennen um gefährdete Pfründe als an ein wohl durchdachtes kooperatives Konzept. Allerdings sind dieses Vorgehen und die daraus resultierende Situation, in der unterschiedliche Allianzen – etwa zwischen DocMorris und dem Spitzenverband der Fachärzte – gebildet und wieder gelöst werden können, typisch für tagespolitisch getriebene Reaktionen. Wenn der potenzielle Nutzen der Digitalisierung aber über die bloße Belieferung eines Rezeptes hinausgehen soll, muss eine neue Verordnung in das individuelle Arzneimittelprofil integriert werden können, um die einzelnen Medikationschecks durchzuführen. Das aber leisten die bisher bekannten E-Rezept-Apps offenbar noch nicht, zumal bislang auch die technischen Voraussetzungen in den Apotheken nicht flächendeckend geschaffen sind.
Dass mit der vom Deutschen Apothekerverband (DAV) entwickelten E-Rezept-App die Erwartung verbunden war, die Verordnung in eine bestimmte Apotheke zu lenken (und dass dafür 80 Prozent der Apotheken teilnehmen müssten), schien aus Sicht der reinen Vertriebslogistiker erwartungsgemäß ein Denkfehler [4], aber vom Ansatz her richtig zu sein. Dies trifft allerdings nur dann zu, wenn eine Verknüpfung mit pharmazeutischen Dienstleistungen, insbesondere dem Medikationsmanagement, gewährleistet werden kann. Davon dürfte aber auch die jetzt von Gesundheitsminister Spahn favorisierte „staatliche App“, die durch die Gematik umgesetzt werden soll, noch weit entfernt sein. Die gleichzeitig vorgesehene Übertragbarkeit von E-Rezepten durch den Patienten in andere Apps dürfte darüber hinaus die Erprobungszeit deutlich verlängern und verhindert auch weitere Wettbewerbsverzerrungen nicht [10]. Dass nahezu zeitgleich sogenannte Vorbestell-Apps verschiedener Anbieter, u. a. die Großhändler Phoenix und Noweda, aber auch von Amazon Pharmacy oder der britischen Online-Arztpraxis Zava im Verein mit der deutschen Noventi auf den Markt kommen, ist kein Zufall, wird aber auch neue versandtechnische Lösungen mit sich bringen. Auch DocMorris suchte inzwischen eine Kooperation mit Vor-Ort-Apotheken, wodurch gleichzeitig eine neue Art von Netzverbünden entsteht, die Kaufwünsche oder auch Rezeptbestellungen auf die teilnehmenden Apotheken ausrichten sollen und damit zu Wettbewerbsverzerrungen führen [5].
2. Die elektronische Patientenakte
Für die elektronische Patientenakte, die seit Jahren im Gespräch ist und inzwischen durch Eigenentwicklungen von Krankenkassen forciert wird, liegt der unmittelbare Nutzeffekt klar auf der Hand: Heilberufler und Patienten hätten nach zuvor festgelegten Regeln Zugriff auf ihre Gesundheitsdaten, so dass wiederholte Mehrfachuntersuchungen unnötig werden und der zeitliche Verlauf von Erkrankungen besser abgebildet werden kann.
Archivieren ist nicht alles! Bei der elektronischen Patientenakte sollte die Datenauswertung mithilfe komplexer Auswertungsalgorithmen im Vordergrund stehen. Das nützt dem Patienten und dient dem medizinischen Erkenntnisgewinn. Doch in der ersten Ausbaustufe der elektronischen Patientenakte ist lediglich eine Archivierung von PDF-Dokumenten vorgesehen.
Gleichermaßen von Bedeutung für die durch Digitalisierung zu erzielenden Nutzeffekte wäre aber eine breite Auswertung dieser Daten für den medizinischen Erkenntnisgewinn, was meist mit dem Begriff der künstlichen Intelligenz (KI) umschrieben wird. Das setzt aber nicht nur eine standardisierte Dokumentation und Archivierung der individuellen Daten in definierten und einzeln ansteuerbaren Datenfeldern voraus, sondern auch die Entwicklung von komplexen Auswertungsalgorithmen, die reproduzierbare Ergebnisse liefern und im Idealfall zu neuen Einsichten bei der Behandlung von Erkrankungen führen. Eine derartige Auswertung ist alles andere als banal und gleichzeitig ein zeitaufwendiger Prozess, der durch den einzelnen nicht auf Knopfdruck erledigt werden kann. Vielmehr erfordert er eine gezielte Selektion und Bereinigung der relevanten Daten, um bisher unbekannte, aber auch bekannte Assoziationen aufzudecken. Die durch zuvor programmierte Analysenprogramme (also „Algorithmen“) ermittelten Ergebnisse müssen anschließend dahingehend bewertet werden, inwieweit sie auf einen individuellen Fall zutreffen oder auch nicht. Da statistische Ergebnisse immer durch eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Wahrscheinlichkeit und damit Unsicherheit gekennzeichnet sind, erfordert ihre Bewertung in der Regel fachliches Wissen und kann nicht dem Einzelnen oder gar dem Patienten selbst zugemutet werden.
Da die erste Ausbaustufe der elektronischen Patientenakte aber lediglich eine Archivierung von pdf-Dokumenten vorsieht [11], bleiben entsprechende Überlegungen ohnehin Zukunftsmusik. Gerade deshalb müssen die notwendigen Vorarbeiten für die Standardisierung, Strukturierung und Flexibilisierung von medizinisch sinnvollen Auswertungsansätzen gesundheitlicher Daten unter strikter Beachtung des individuellen Datenschutzes forciert werden.
3. Gesundheits-Apps
Der Markt für Gesundheits-Apps ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen und wird dies auch weiterhin tun. Denn der Zeit- und Kostenaufwand für die Entwicklung von Apps ist überschaubar. Soweit sie im Geltungsbereich des Medizinproduktegesetzes (MPG) liegen und einer bestimmten Risikoklasse zugeordnet wurden, sind sie zulassungspflichtig, so dass hier eine gewisse Orientierungshilfe gegeben wird [6]. Kriterien für die differenzierte Nutzenbewertung von Gesundheits-Apps wie sie kürzlich durch das NICE für Großbritannien vorgelegt wurden, stehen für Deutschland jedoch noch aus.
Medizinische Apps sollten nicht gegen geltende gesetzliche Regeln verstoßen und ethisch akzeptabel sein. Daher ist ein Zulassungsverfahren unumgänglich.
Apps zur Dokumentation individueller physiologischer Daten spielen für die Apotheke zunächst keine Rolle, außer dass ihre Verwendung ein besonderes Interesse des Nutzers für die eigene Gesundheit erkennen lässt. Ob für diese Zielgruppe Empfehlungs-Apps zur Steigerung der Leistungsfähigkeit durch Anwendung unterstützender Arzneimittel in Umlauf gebracht werden, wird sich zeigen. Denkbar wäre auch eine App mit Empfehlungen von OTC-Arzneimitteln bei banalen Beschwerden, die nicht nur einen Preisvergleich ermöglichen sollten – denn der interessiert die potenziellen Anwender ebenso wie die Wahrscheinlichkeit eines gewünschten Wirkungseintritts – sondern auch Hinweise darauf geben müssen, wann unbedingt ein Arzt aufzusuchen ist.
Eine weitere zunehmend auf den Markt dringende Gruppe von Apps betreffen „Eigendiagnosen“ zu bestimmten Erkrankungen wie Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, HIV oder auch Demenz und Depression. Die Diagnose-App des Start-ups Ada Health [7] erlaubt zum Beispiel über einen KI-gesteuerten Fragenkatalog, mit dem Symptome und Beschwerden abgefragt werden, einen Diagnosevorschlag. Auf dessen Grundlage soll der Betreffende entscheiden, ob er zum Arzt geht oder eine Selbstbehandlung versucht.
Für Apotheken werden solche Apps wichtig, wenn daraus Anwendungsvorschläge für Arzneimittel abgeleitet werden. Bei Ada Health weist z. B. die medizinisch am wenigsten dringliche Empfehlung darauf hin, „abzuwarten oder ein OTC-Arzneimittel zu verwenden“, ohne dass dies bisher weiter konkretisiert wird. Dies wäre demnach ein weiteres Feld der Zusammenarbeit von Ärzten und Apothekern. Allerdings muss das offensive Werbeverhalten von Ada Health ebenso im Auge behalten werden wie die Nutzungsrechte und Verwertungsmöglichkeiten der erhobenen Daten.
Grundsätzlich gilt, dass Apps, aber auch Medizinprodukte allgemein eine Breitenwirkung nur dann entfalten können, wenn sie von einer kritischen Masse von Nutzern verwendet werden und diese ihren Nutzen unmittelbar und auch reproduzierbar erfahren können. Das setzt in der Regel voraus, dass sie eine wie auch immer geartete staatliche Zulassung aufweisen können, nicht gegen geltende gesetzliche Regeln verstoßen und ethisch akzeptabel sind. Für die Verschreibungsfähigkeit bzw. die Übernahme durch die Krankenkassen, wie sie in Einzelfällen jetzt schon möglich ist, wird man aber langfristig nicht um einen Nachweis des medizinischen Nutzens herumkommen.
Fazit und Ausblick
Der Versuch einer Standortbeschreibung zur Digitalisierung in der Apotheke kann immer nur eine Momentaufnahme sein, da praktisch täglich Meldungen durch die Presse gehen, die von Relevanz für die weitere Entwicklung sind und sie nachhaltig beeinflussen können. Schwer abzuschätzen sind auch die Folgen der zunehmenden Digitalisierung, die die gesamte Gesellschaft betreffen, insbesondere der steigende Energieverbrauch für die Archivierung der Daten. Das beträfe u. a. die breite Einführung der Blockchain-Technologie, die gerade bei Arzneimitteln zur Sicherung der Lieferketten von Bedeutung wäre.
Die oft mangelhafte Interoperabilität bei einer historisch gewachsenen Implementierung digitaler Teillösungen (unter der z. B. auch die Krankenhausapotheken zu leiden haben) verhindert dabei nicht selten die Kooperationsfähigkeit und macht das bestehende System anfällig für die Etablierung neuer, konkurrierender Strukturen und Funktionsmodelle.
In dieser Situation, in der jeder einzelne nur einen Ausschnitt der Realität überschaut, sind deshalb Empfehlungen etwa vonseiten der jeweiligen Berufsverbände dringend geboten und werden als Orientierungshilfe gebraucht. Die Apothekerschaft sollte deshalb erwägen, eine eigene Apotheken-IT-Taskforce aufzubauen, in der digital-affine Apotheker mit medizinisch-pharmazeutisch interessierten Informatikern zusammenarbeiten. Deren Aufgabe wäre es, die digitale Entwicklung kritisch und konstruktiv zu begleiten, eigene passfähige Lösungsansätze zu erarbeiten und gleichzeitig Servicedienste für die Anwender bei der Umsetzung anzubieten. Eine Kooperation mit Testapotheken, in denen digitale Lösungen erprobt und angepasst werden können, ist dabei vermutlich unerlässlich.
Naheliegendste Partner für alle Digitalisierungsprozesse in der Apotheke sind die Softwarehäuser, zu denen in der Regel eine langjährige Bindung besteht, schon deshalb, weil die Umstellung auf ein neues Apothekensoftwaresystem aufwendig ist. Allerdings waren und sind die Softwarehäuser fast durchgängig mit der Implementierung neuer regulatorischer Anforderungen oft so ausgelastet, dass die Programmierkapazität für andere innovative Projekte oder die Optimierung von bereits verfügbaren Produkten fehlt [8]. Da sich diese Situation in naher Zukunft kaum ändern dürfte, spricht auch dieser Umstand dafür, dass die Apothekerschaft zusätzlich eine eigene Taskforce mit digitaler Kompetenz aufbaut, die die durch die Digitalisierung ausgelösten Veränderungsprozesse begleiten kann, ohne selbst durch das Tagesgeschäft gebunden zu sein.
Grundsätzlich sind alle vertriebslogistischen Aufgaben des Apothekers zu ersetzen, inklusive einer Art Grundberatung, die die veröffentlichten Informationen zu einzelnen Arzneimitteln adaptieren. Das Einzige, was moderne Vertriebslogistik auch im Verein mit künstlicher Intelligenz nicht ersetzen kann, ist das fachliche Wissen und die daraus resultierende Bewertungskompetenz, die durch ein Hochschulstudium erworben und in lebenslanger Weiterbildung aktuell gehalten wird. Denn nur sie erlaubt es, dem einzelnen Patienten Zusammenhänge zu erläutern und die individuelle Relevanz von verallgemeinerten Algorithmus-Empfehlungen zu erklären. Zudem sind Apotheken schon immer lokale Zentren des sozialen Lebens und des Austauschs zu Gesundheitsfragen gewesen. Diese Aufgaben werden, eingebettet in einen erkennbareren Trend zum Ausbau unterschiedlicher Arten von Nachbarschaftshilfe Bestand haben, auch über den Hype der Digitalisierung und den Wunschvorstellungen hinaus, was künstliche Intelligenz alles bewirken kann. Zudem ist die Apotheke eine wohnortnahe Gesundheitseinrichtung, die laut einer kürzlichen Umfrage durchschnittlich nur 2,9 Kilometer von der eigenen Wohnung entfernt ist [9].
Die absehbare Entwicklung im Gesundheitssystem erfordert aber auch, dass die Apothekerschaft ihr Berufsbild neu definiert und vor allem praktiziert. Keine leichte Aufgabe, aber die vielleicht einzig mögliche, um die Institution Apotheke als lokales heilberufliches Zentrum zu erhalten.
Der vielleicht größte Vorteil der etablierten Apotheken ist, dass sie seit Langem im Markt sind und in der Regel eine enge Bindung an ihre Kunden und Patienten haben. Sie müssen also nicht wie Konkurrenzanbieter einen „Markt neu erobern“, sondern lediglich die Herausforderung annehmen, sich dem digitalen Wandel aktiv und nicht nur reaktiv zu stellen und ihre Dienstleistungen anzupassen, ohne dabei in digitalen Aktionismus zu verfallen. |
Literatur
[1] Visarius, J. „Was ist digitale Transformation“. In: Netzwerke für Gesundheit, Magazin der Betriebskrankenkassen 03/2019, S. 26 – 33
[2] Grätzel von Grätz, Ph.: E-HEALTH-COM vom 03.06.19
[4] Aufbruchstimmung für die Digitalisierung. DAZ 2019, Nr. 22, S. 70
[5] Apotheker Zeitung, AZ 2019, Nr. 24, Seite 4
[6] Orientierungshilfe Medical Apps des BfArms/ https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Abgrenzung/MedicalApps/_node.html Stand 09.10.2015
[8] Schüller, T.: Das digitale Herz einer jeden Apotheke. Ein Überblick über den Markt der Softwareanbieter. DAZ 2019, Nr. 18, S. 52
[9] Pressemitteilung BAH, Gesundheit AdHoc 20.9.2019)
[10] Was bringt Spahns Patientendaten-Schutzgesetz? DAZ 2020, Nr. 6, S. 12
[11] Ludewig, G.: TSVG, elektronische Patientenakte, Digitale-Versorgung-Gesetz – Aufgaben für Kassen, Leistungsanbieter und neue Player, Vortrag Spreestadt- Forum Berlin am 27.01.2020

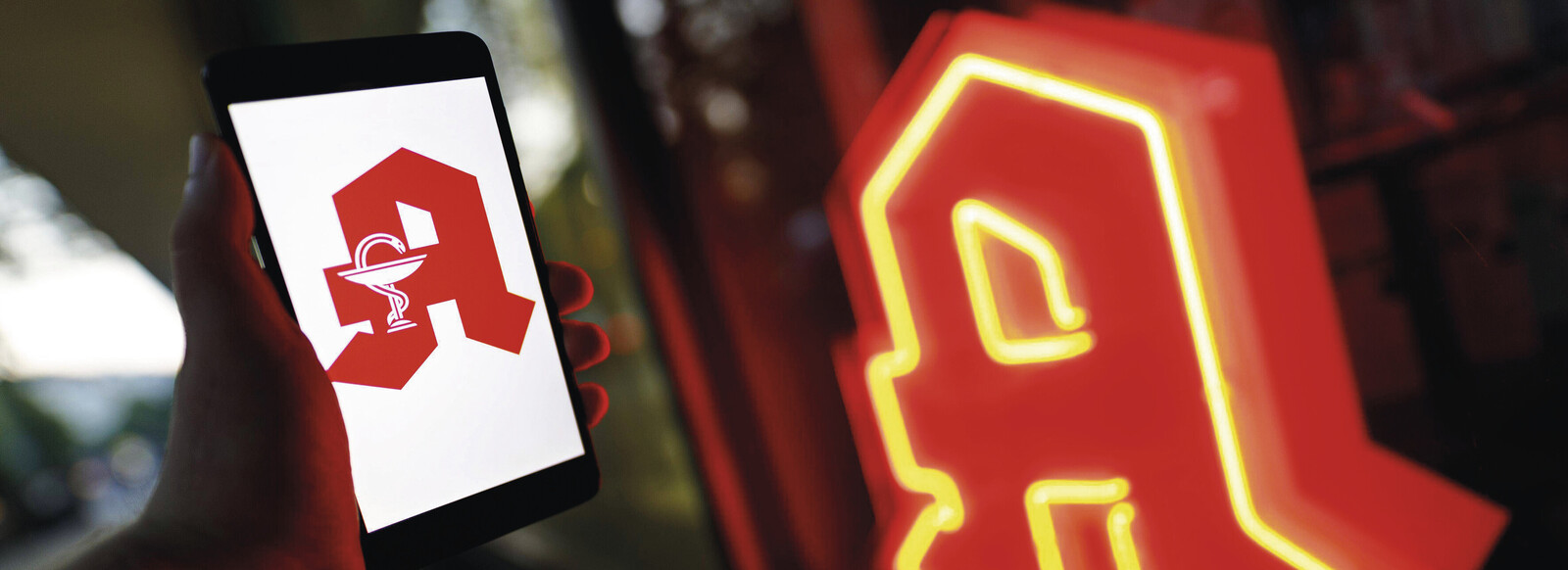
























0 Kommentare
Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.