
- DAZ.online
- News
- Spektrum
- Digitale ...
Digital-Konferenz „Futurelink“
Digitale Patientenkommunikation: Technik versus Emotion
München - 18.06.2018, 17:45 Uhr
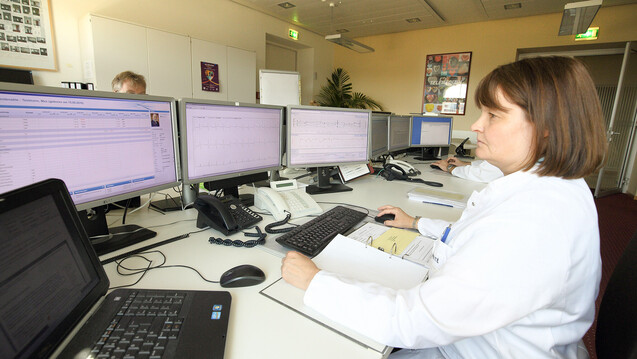
Ärzte mit digitalem Patientenkontakt: Kritikern zufolge gehen dabei wichtige Versorgungsmerkmale verloren. (Foto: Imago)
Die Kommunikation zwischen Arzt beziehungsweise Apotheker und Patient wird künftig vielfach digital ablaufen, so die Annahme. Doch in der Praxis ist die Sache nicht so einfach, wie es scheint. Fachleute wiesen auf der Digitalisierungs-Konferenz „Futurelink“ darauf hin, dass dem Patienten vor allem an einem guten Gefühl gelegen ist. Positive Emotionen des Patienten bedürfen in der Regel aber des direkten Kontakts zu Arzt und Apotheker.
Die schöne neue Welt der digitalen Patientenkommunikation, also von Arzt zu Patient oder von Apotheker zu Patient, klingt einfach und überzeugend: Der Patient wird per Ferndiagnose vom Arzt untersucht, er erhält digital seinen Behandlungsplan, er bestellt digital seine Arzneimittel und er surft in der digitalen Welt, um sich aktuelle Informationen zu seinem Krankheitsbild zu besorgen. Die Anamnese und Behandlung vom Wohnzimmer aus spart Zeit, unter Umständen eine Menge Geld und erhöht die Effizienz im Gesundheitswesen.
Teile dieser Vision sind bereits auf dem Weg zur Wirklichkeit. Mit der zunehmenden digitalen Entwicklung sind die Grundlagen für die neue Art der Medizin gegeben. Begünstigend kommt hinzu, dass die Patienten ohnehin bereits intensiv im digitalen Kosmos unterwegs sind. David Rowan, ehemaliger Gründungschefredakteur des namhaften US-Technologiemagazins Wired und heute Vortragsreisender in Sachen digitale Neuerungen, verwies auf der Digitalisierungs-Konferenz „Futurelink“ in München auf Untersuchungen, wonach die Menschen im Jahr 2008 täglich durchschnittlich drei Stunden mit digitalen Medien verbracht haben, während es heute bereits sechs Stunden seien. Gute Voraussetzungen dafür, dass der Arzt seinen Patienten künftig verstärkt in der digitalen Welt trifft. Seit einigen Monaten gibt es zumindest in Teilen Deutschlands nun auch ärztliche Berufsordnungen, die das zulassen. In Baden-Württemberg laufen bereits erste Projekte.
„Biologie wird Software“
Andererseits verwies Rowan darauf, dass die Biologie im Vergleich zu anderen Wissensbereichen bislang weitgehend schwach in den neuen Technologien unterwegs sei. Auch die Pharmabranche hinke diesbezüglich dramatisch hinter anderen Industrien her. Doch gerade darin sieht Rowan eine große Chance – „Biologie wird Software“, ruft er in verkürzter Form seinem Publikum zu. Das werde sich auch im Verhältnis Arzt-Patient niederschlagen: „Die Behandlung von Patienten wird im digitalen Zeitalter zunehmend automatisiert sein“, so Rowan.
Doch so einfach wie von den Digitalisierungs-Apologeten gedacht, wird der Kommunikationswandel in der Gesundheitsbranche möglicherweise nicht vonstattengehen. Auf der Münchener Futurelink-Konferenz erklärte der Arzt Dr. Andreas Keck, dass dieses Unterfangen mit stattlichen Hürden zu kämpfen habe. Keck argumentiert dabei nicht aus dem Bauch heraus, er kann auf zehn Jahre ärztliche Praxis in einem kardiologischen Labor verweisen, wo er täglich 100 Patienten gesehen und viele von ihnen selbst behandelt hat. Nach mehreren Jahren in dem Beratungsunternehmen Boston Consulting Group arbeitet er heute als Vorstandsvorsitzender am Strategy Institute for Digital Health (Syte) in Hamburg, einem Think Tank für digitale Gesundheitsentwicklungen und -kommunikation.
Wer kommt für die digitale Kommunikation in Frage?
Ausgangspunkt von Kecks Erkenntnissen ist die Tatsache, dass
der Patient die Krankenstation als unangenehmen Ort empfinde. Einzig die
Krankheit zwinge ihn dazu, dort zu sein. Tatsächlich wolle er nur eines – raus
von dort. In seiner ärztlichen Praxis wie auch durch wissenschaftliche
Untersuchungen hat der Arzt und Digitalexperte verschiedene Typen von Patienten
und deren Verhaltensweisen definiert: Die große Mehrheit sei unzufrieden mit
ihrer Krankheit. Diese Menschen seien sehr still und kommunizierten nicht oder
fast nicht. Bei dieser Patientengruppe stelle sich die Frage, wie sie mittels der
digitalen Kommunikation erreicht werden könne, wenn sie schon im direkten Austausch
mit dem Arzt kaum rede. Darüber hinaus seien 15 bis 20 Prozent der Patienten sehr
ängstlich und verkrampft, beispielsweise angesichts einer entscheidenden
medizinischen Untersuchung und deren ungewissen Ausgangs. Schließlich gebe es eine
etwa 10 bis 15 Prozent große Gruppe, die regelrecht wütend sei und den Arzt für
ihren gesundheitlichen Zustand verantwortlich mache. Diese Patienten seien teilweise
unfreundlich, ja sogar aggressiv und kommunikativ schwer zu erreichen.
Nur 40 Prozent der Patienten erreichbar
Keck kommt zu dem Ergebnis, dass man unter dem Strich nur rund 40 Prozent der Patienten kommunikativ erreichen könne. Die meisten von diesen seien zwar generell an Informationen interessiert, selber aber nicht sehr aktiv. Lediglich 10 Prozent seien sehr interessiert und würden sich auch auf den existierenden Portalen im Internet bewegen und informieren. Das Gros der Patienten aber, nämlich etwa 60 Prozent, würden von sich aus nicht oder kaum kommunizieren und seien daher auch kaum erreichbar.
Erschwerend kommt nach Angaben des Arztes und Wissenschaftlers hinzu, dass die Zeit des Arztes mit dem Patienten üblicherweise sehr begrenzt ist – im Durchschnitt gerade mal drei Minuten. In dieser kurzen Zeitspanne würden die Patienten dann auch noch vergessen, die Hälfte ihrer Fragen zu stellen. Nach einer weiteren Stunde hätten sie zudem 80 Prozent der Aussagen des Arztes vergessen, beruft sich Keck auf Zahlen seines Institutes. Abgesehen davon gebe es Fragen, die Patienten nach seiner Erfahrung so gut wie nie stellten, beispielsweise von welchen Pharmaunternehmen die Arzneimittel stammen, die sie einnehmen. „Patienten kennen in der Regel die Marke ihres Shampoos, aber nicht ihrer Medizin“, so Keck und fügt scherzhaft hinzu: „Das dürfte ein Problem für die Pharma-Brandmanager sein.“ Was die Patienten wirklich interessiere sei die Frage, wann sie wieder gesund sein werden.
Keck: Direkter Kontakt trägt zum Wohlbefinden der Patienten bei
Vor diesem Hintergrund sieht der Wissenschaftler vor allem die Emotionen des Patienten als ein entscheidendes Kriterium für eine erfolgreiche ärztliche Kommunikation. Wenn der Arzt den Namen des Patienten und einige persönliche Dinge weiß, wenn er ihm ein Lächeln schenkt und in die Augen schaut, wenn er dem Patienten zuhört und nicht unterbricht, ihm die Hand auf die Schulter legt und Fragen zu nicht-medizinischen Themen stellt, trage das erhebliche zum Wohlbefinden des Patienten bei und erleichtere den Zugang zu ihm. Auf diese Weise werde die Basis für eine erfolgreiche Kommunikation und Behandlung gelegt. Keck verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff der „mitfühlenden Gesundheit“. Patienten, so der Arzt, wollen sich komfortabel, sicher und relaxed fühlen. Wenn das nicht gegeben sei, sei auch das Engagement der Patienten und damit deren Bereitschaft, (digital) zu kommunizieren, gering. „Es geht nicht um Technik, es geht um Emotionen“, so der Mediziner.
Direkter Kontakt zum Apotheker
Diese Erkenntnis dürfte auch für Apotheker interessant sein. Denn sie bestärkt die These, dass für viele Patienten und Kunden die direkte Ansprache wichtig ist. Wie wichtig eine gute Kommunikation zwischen Arzt beziehungsweise Apotheker und Patient ist, zeigt laut Keck auch die Tatsache, dass im Jahr 2025 ein Großteil der Medikamente in den Bereich der personalisierten Medizin fallen werde. Bei diesen Produkten sei es besonders wichtig, die Patienten umfassend zu informieren, damit die Produkte ihre volle Wirkung entfalten können.
Mit der zunehmenden Digitalisierung der Patientenkommunikation wird allerdings auch der Fluss und die Speicherung sensibler und patientenbezogener Daten über diese Kanäle erheblich zunehmen. Kritiker mahnen, dass damit auch die Gefahr eines Missbrauchs stark ansteigt. Doch für Digitalisierungsoptimisten wie David Rowan, scheint das kein großes Thema zu sein: Er spricht in München lieber über die Chancen, die diese Technologie bietet, als über die damit verbundenen Gefahren.


















1 Kommentar
Digital - Großkapital
von Ratatosk am 18.06.2018 um 18:28 Uhr
» Auf diesen Kommentar antworten | 0 Antworten
Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.