
- DAZ.online
- DAZ / AZ
- DAZ 5/2020
- Infektionskrankheiten so ...
Kongresse
Infektionskrankheiten so vielfältig wie die Erreger selbst
50. Pharmacon-Kongress, zum sechsten Mal in Schladming
Daneben existieren natürlich auch ein Rahmenprogramm und die Möglichkeit, einer bevorzugten Wintersportart nachzugehen. Bis 2014 fand der Kongress im schweizerischen Davos statt, seit 2015 ist er nun im österreichischen Schladming beheimatet. Dieses Jahr drehten sich die Vortragsthemen rund um die „Prophylaxe und Therapie von Infektionskrankheiten“.
Warum bekomme gerade ich eine Erkältung?
In der kalt-feuchten Erkältungszeit hustet und schnieft alles um uns herum, und trotzdem werden manche gar nicht krank, während andere gefühlt jeden Schnupfen mitnehmen. Warum das so ist, erklärten Dr. Ilse Zündorf und Prof. Dr. Robert Fürst von der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt. Neben der genetischen Ausstattung des menschlichen Wirts liegt das auch am Erreger, nämlich an dessen Virulenz bzw. seiner Pathogenität. Beide Begriffe werden oft synonym verwendet, sollten aber unterschieden werden: die Virulenz beschreibt die Infektionskraft eines Erregers, die Pathogenität die Fähigkeit, eine Krankheit auszulösen. Denn Erreger unterscheiden sich in der Mindestanzahl an Pathogenen, die für eine Infektion notwendig sind. So reichen beim Hepatitis-A-Virus ein bis zehn Viren für eine Infektion, beim Noro-Virus oder bei Escherichia coli sind es zehn bis 100. Bei Vibrio cholerae muss man für eine Ansteckung mit deutlich mehr Erregern in Kontakt kommen, nämlich 104 bis 108. Sehr ansteckend sind auch die Windpocken: Nahezu alle Exponierten stecken sich an und erkranken auch. Ebenso „effektiv“ ist das Masern-Virus. Hier sorgt die „Ansteckungskraft“ dafür, dass es immer wieder zu größeren Ausbrüchen in ungeimpften Populationen kommt.
Das Individuum als Metaorganismus
Prof. Dr. Thomas Bosch von der Christian-Albrechts-Universität Kiel erläuterte die Bedeutung unserer Mikrobiota für die Gesundheit. Alle Oberflächen wie unsere Haut und Schleimhäute und auch einige Organe sind mit einer Vielzahl von Mikroorganismen (Bakterien, Viren, Pilzen) besiedelt. Diese komplexe Gemeinschaft vieler Arten ist über Millionen von Jahren gemeinsam entstanden und eng miteinander vernetzt. Nur langsam beginnen wir zu verstehen, wie viele Funktionen die Mikrobiota erfüllen. Sie interagiert nicht nur mit dem Immunsystem, sondern Neuronen kommunizieren mit Bakterien – und Bakterien interagieren mit Nervenzellen. Dem Nervensystem wird schon eine neue Rolle zugesprochen: Nervenzellen dienen nicht nur der Wahrnehmung und der motorischen Koordination, sondern auch der Kommunikation mit Bakterien. Dabei können Antibiotika eine große Bedrohung sein, denn die Mikrobiota helfe auch, Pathogene zu verdrängen, so Bosch. Deutlich wird das z. B., wenn Antibiotika lokal im Mundraum angewendet werden und ein Mundsoor entsteht. In Störungen des Mikrobioms sieht Bosch auch eine Ursache für die nur schwer erklärbare Verschlechterung unserer Gesundheit in den letzten 50 Jahren: Die sogenannten noncommunicable diseases nehmen im industrialisierten Teil der Welt zu. Darunter versteht man Erkrankungen, die nicht direkt von einer Person auf andere übertragen werden können, wie neurodegenerative Erkrankungen, multiple Sklerose, Reizdarmsyndrom, Asthma, Morbus Crohn oder Adipositas. Als Ursache wird eine stark reduzierte Artenvielfalt der Mikrobiota diskutiert – als Folge des vermehrten Antibiotikaeinsatzes. Aber auch durch die Möglichkeit, dass Mikrobiota von Mensch zu Mensch übertragbar sind. Beim Menschen wird eine solche Übertragung bereits als fäkale Mikrobiota-Transplantation zu therapeutischen Zwecken genutzt.
Bosch gab den Zuhörern etwas zum Nachdenken auf den Weg: Ändert die Tatsache, dass unser Organismus mehr Mikroben beherbergt als eigene Zellen, unsere Vorstellung vom menschlichen Selbst? Wodurch wird man „selbst“? Durch unser Gehirn? Durch das Immunsystem? Unser Genom? „Erst wenn wir uns als einen Teil von multi-organismischen Netzwerken begreifen und loslassen von der Idee, nach der der Körper ausschließlich aus menschlichen Zellen besteht, erreichen wir die Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit gegenüber einer sich ständig verändernden Umwelt“, so Bosch.
Impfungen können Leben retten
… aber nur, wenn die Durchimpfungsrate hoch ist! Gerade die Influenza gilt als eine impfpräventable Erkrankung, bei der die große Krankheitslast und auch die Anzahl der Todesfälle erheblich reduziert werden könnten, wie Prof. Dr. Thomas Weinke vom Klinikum Ernst von Bergmann Potsdam zeigte. Eine schwere Grippewelle wie die von 2017/2018, bei der in Deutschland über 300.000 Erkrankungen als gesichert gelten, führte zu ca. neun Millionen Influenza-bedingten Arztbesuchen, ca. 60.000 stationären Aufnahmen und zu vielen zusätzlichen Todesfällen – eine Belastung, die vermeidbar wäre. Denn auch wenn die Influenza-Impfstoffe mit einer Effektivität von 50 bis 70% nur zu den mäßig effektiven zählen, so schützen sie nicht nur vor der Influenza, sondern auch vor sekundären Pneumonien sowie systemischen Inflammationen. Das Risiko für eine Influenza-bedingte Mortalität vor allem bei den Älteren und Jüngeren mit Komorbiditäten lässt sich erheblich reduzieren. Denn belegt ist, dass eine Infektion mit dem Influenza-Virus den Weg bahnt für viral-bakterielle Synergien: Kommt es zu einer sekundären Pneumokokken-Infektion, so nimmt die bakterielle Adhärenz zu, es ändert sich die Immunantwort, die Hämagglutinin-Effektivität wird durch bakterielle Proteasen erhöht, und auch der Tropismus des Influenza-Virus kann sich ändern. Folgen sind vermehrte systemische Entzündungsreaktionen bis hin zu einer erhöhten kardiovaskulären Morbidität. Weinke zitierte den Präsidenten des Robert Koch-Instituts Prof. Dr. Lothar H. Wieler: „Mit keiner anderen Impfung lassen sich hierzulande mehr Leben retten!“. Apotheker als Teil der „medizinisch-pharmazeutischen Community“ sollten hinter den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut stehen und diese offensiv nach außen vertreten, so der Wunsch Weinkes. Denn die STIKO ist ein unabhängiges und neutrales Expertengremium, das evidenzbasierte Empfehlungen ausspricht – und die Apotheke bietet ein niederschwelliges Angebot zur Information und vielleicht auch bald flächendeckend zur Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Im Rahmen von Modellprojekten, die zum 1. März 2020 starten, können Kassen mit Apotheken Verträge abschließen, die die Impfung gegen Influenza in den Offizinen ermöglichen. Diese Pilotprojekte zur Grippeschutzimpfung werden zeigen, ob es gelingen kann, die Impfquoten zu erhöhen, wie es das erklärte Ziel der Politik ist. Das Thema ist aber in der Apothekerschaft umstritten, bedauerte Weinke. Während es einige als Chance begrüßen, sehen andere eher Probleme und fürchten den Unmut der Ärzte.
Die mühsame Suche nach neuen Antibiotika
„Wir brauchen neue Konzepte!“ Diese klare Forderung stellte Prof. Dr. Ulrike Holzgrabe aus Würzburg, die sich seit vielen Jahren mit der Entwicklung von neuen Antibiotika und Antibiotikaresistenzen beschäftigt. Dringend sollten ausgetretene Wege verlassen und neue beschritten werden. Auch sollten Antibiotika entwickelt werden, die so stark metabolisiert werden, dass ihre Metaboliten in der Umwelt nicht mehr wirken. Bis dahin sollte durch einen achtsamen Einsatz von Antibiotika der Resistenzdruck gesenkt und so die Wahrscheinlichkeit der Resistenzbildung verringert werden. In der Tiermast sollten wesentlich weniger Antibiotika eingesetzt und bereits bei der Produktion der Wirkstoffe darauf geachtet werden, dass keine Antibiotika in die Umwelt entlassen werden, so ihre konkreten Forderungen. Denn es werde sehr lange dauern, bis aus der fast leeren Pipeline der pharmazeutischen Industrie wieder Antibiotika herauskommen, die meisten Kandidaten befinden sich erst in präklinischen Phasen. Leider steigen immer mehr Pharmaunternehmen aus der Entwicklung von neuen Antibiotika aus. Das „goldene Zeitalter der Antibiotika-Neueinführungen“ sei vorüber, so Holzgrabe. Sieht man von wenigen Ausnahmen ab, so sind in den vergangenen 50 Jahren keine neuen Antibiotika-Gruppen auf den Markt gekommen. Am dringendsten fehlen neue Antibiotika gegen gramnegative Bakterien wie die Carbapenem-resistenten Actinebacter, Pseudomonaden und Enterobacteriaceae. Diese haben zum einen eine Zellwand aus Lipopolysacchariden, die nur für kleine, hydrophile Substanzen durchlässig ist und nicht für große, lipophile Naturstoffe, und zum anderen besitzen sie viele unterschiedliche Effluxpumpen, die zuverlässig und flexibel Xenobiotika – und damit auch Antibiotika – wieder aus der Bakterienzelle transportieren.
Antibiotikaresistenz ist ein globales Problem
Auch der Blick auf die weltweite Situation bei den Antibiotikaresistenzen ist nicht wirklich beruhigend, wie Prof. Dr. Matthias Willmann von der Universität Tübingen zeigte: Gegenwärtig werden ca. 700.000 Todesfälle jährlich als Resultat von Infektionen mit resistenten Mikroorganismen angesehen, 2050 sollen das nach Schätzungen bereits zehn Millionen Todesfälle sein. Leider gäbe es auf dem Gebiet der Antibiotikaforschung nicht sehr viel Neues: Es gilt immer noch, dass die Standardhygiene effektiv ist, da es kaum Resistenzen gegen Desinfektionsmittel gibt. Er nannte als eine Neuerung eine Änderung bei der Definition der Begrifflichkeiten. Bisher wurde bei der Befundung „sensibel“ damit definiert, dass ein Erreger gegenüber der Standarddosis eines Antibiotikums mit hoher Wahrscheinlichkeit empfindlich ist und daher mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit therapiert werden kann. „Resistent“ bedeutete, dass der Erreger gegenüber der Standarddosis und auch einer erhöhten Dosis eines Antibiotikums mit hoher Wahrscheinlichkeit unempfindlich ist und daher mit diesem Antibiotikum nicht therapiert werden darf. Und dann gab es bisher noch den Ausdruck „intermediär“, abgekürzt „i“. Damit wurden bei der Interpretation der Befunde unklare Situationen bezeichnet („I don’t know“), in der Regel wurden durch den behandelnden Arzt diese Erreger als resistent bewertet. Nach einer neuen Definition des European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST), die seit dem 1. Januar 2020 Gültigkeit hat, steht das „i“ für sensibel bei erhöhter Exposition: Ein Mikroorganismus wird so kategorisiert, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen therapeutischen Erfolg gegen einen Erreger besteht, sofern dieser einer höheren oder intensiveren Antibiotikaeinwirkung ausgesetzt wird. Das heißt, dass nach der neuen Definition das „i“ im Befund nicht mehr bedeutet, dass der Erreger resistent ist, sondern, dass wahrscheinlich das Antibiotikum in einer höheren Dosierung oder bei geänderter Darreichungsform wirksam ist.
Willmann betonte, dass gute Hygiene im Krankenhaus weiterhin der beste Weg ist, um Infektionen zu vermeiden, und ein rationaler Einsatz von Antiinfektiva ein guter und sicherer Weg, um die Ausbreitung von Resistenzen zu verhindern. In diesem Zusammenhang stellte Willmann interessante Ergebnisse seiner eigenen Forschung vor, bei der er nach Kofaktoren der Resistenzselektion gesucht hatte. Die Gabe einer definierten Tagesdosis von Cotrimoxazol erhöhte darin erwartungsgemäß das Vorkommen von Sulfonamid-Resistenzgenen bei Darmbakterien, und zwar um ca. 150%. Wurde zusätzlich ein Virustatikum gegeben, so erhöhte sich diese Rate um sage und schreibe ca. 1700%. Da Virustatika als Booster für die Entwicklung von Resistenzen wirken können, fordert Willmann, dass beim Einsatz eines Antibiotikums immer die gesamte Komedikation des Patienten überprüft werden sollte!
Der steinige Weg zur rationalen Antibiotika-Therapie
Das Infektionsschutzgesetz verpflichtet in § 23 Krankenhäuser, Einrichtungen für ambulantes Operieren sowie Vorsorge- und Rehaeinrichtungen zu erfassen, welche Antibiotika in welchem Umfang verordnet werden und diese Informationen auch regelmäßig zu evaluieren sowie auf Resistenzen mit verändertem Verschreibungsverhalten zu reagieren, doch nur ca. 15% der Antibiotika werden in diesen Einrichtungen verordnet. „Der größte Teil wird ambulant verschrieben“, so Edith Bennack, Krankenhausapothekerin aus Köln, und im ambulanten Bereich fehlt solch ein Surveillance-System. Das Bemühen, Antibiotika möglichst rational einzusetzen, das sich hinter der Bezeichnung Antibiotic Stewardship (ABS) verbirgt, dürfe nicht länger nur ein Thema für Krankenhäuser sein, sagte Bennack. Auch im ambulanten ärztlichen Bereich und in der Offizin sollte die bekannte Regel eingehalten werden, wonach bei der richtigen Indikation das richtige Antibiotikum in der richtigen Dosierung über einen angemessenen Zeitraum zu applizieren ist. Apotheker könnten sich für einen rationalen Einsatz von Antibiotika einsetzen, leider biete die Bundesapothekerkammer derzeit nur Apothekern in Krankenhaus- oder Krankenhaus-versorgenden Apotheken die Möglichkeit, die Weiterbildungs-Zusatzbezeichnung „Infektiologie“ zu erwerben, so Bennack. Solch ein Modul sollte auch für Offizinapotheker angeboten werden, so ihr Wunsch.
Infektionen im Urogenitaltrakt
Eine Indikation, bei der oft zu schnell Antibiotika verordnet werden, sind (unkomplizierte) Harnwegsinfekte. Werden bei Patienten mit Symptomen einer Blasenentzündung die Grenzen der Selbstmedikation beachtet, kann auch ohne Antibiotika geholfen werden, betonte Dr. Christian Ude, Apotheker aus Darmstadt. Treten aber Fieber, Rückenschmerzen, vaginaler Ausfluss oder blutiger Urin auf, sollte direkt an den Arzt verwiesen werden, auch Schwangere, Kinder und Patienten mit Grunderkrankungen wie Diabetes mellitus. Wichtig ist auch der Hinweis, dass Harnwegsinfektionen bei Männern immer als kompliziert gelten, bei ihnen könnte auch die Prostata mit betroffen sein. Im Bereich der Selbstmedikation stehen viele Präparate zur Verfügung, was die Entscheidung in der Apotheke erschwert. Ein Großteil sind Phytopharmaka, einige sind als Arzneimittel zugelassen (Wirksamkeit ist durch klinische Daten belegt), andere gehören zu den Kategorien well-established use (Wirksamkeit und Unbedenklichkeit in der Literatur belegt) oder traditional use (kein Wirksamkeitsnachweis erforderlich). Die Evidenz für die Wirksamkeit nimmt in dieser Reihenfolge ab, so Ude. Er präferiere Präparate mit Trockenextrakt aus Bärentraubenblättern oder auch eine Pulverzubereitung aus Kapuzinerkresse und Meerrettich und ein D-Mannose-haltiges Medizinprodukt. Die Wirksamkeit von Cranberry-Präparaten sei umstritten, es stehe auch kein zugelassenes Arzneimittel zur Verfügung. Teezubereitungen, die im Rahmen des traditional use eingesetzt werden, können als Add on bei Harnwegsinfektionen unterstützend wirken, so Ude, sie sollten aber nicht die alleinige Therapie darstellen. Als Argumentationshilfe im Beratungsgespräch kann bei Tees immer auch auf die Löslichkeit (viele Inhaltsstoffe sind nicht in Wasser löslich), die Dosis (Extrakte sind in der Regel aufkonzentriert) und den Herstellungsprozess (Herstellung unter streng überwachten Bedingungen) geschaut werden – hier gibt es große Qualitätsunterschiede zu Produkten, die in Supermärkten angeboten werden. Kommen Patienten mit Beschwerden im Urogenitaltrakt, so sollte auch an sexuell-übertragbare Krankheiten wie Syphilis, Gonorrhö, Trichomonaden und Chlamydien gedacht werden. Symptome wie Brennen in der Harnröhre, Jucken oder übelriechender Ausfluss, Schmerzen beim Wasserlassen oder beim Geschlechtsverkehr können auf eine dieser Erkrankungen deuten und einen Arztbesuch erforderlich machen. Vor allem bei der Abgabe von Arzneimitteln zur HIV-Präexpositionsprophylaxe (HIV-PrEP), die nicht vor den genannten sexuell übertragbaren Krankheiten schützt, oder bei der Beratung zu einer Notfallverhütung sollten Apotheker entsprechend aufklären. Denn Untersuchungen zeigen, dass fast bei drei Viertel derjenigen, die eine HIV-PrEP nutzten, im ersten Jahr der Anwendung die Diagnose Tripper, Syphilis oder Chlamydien-Infektion gestellt wurde.
Hautinfektion kann „an die Nieren gehen“
Etwa jede vierte Hauterkrankung ist auf eine Infektion mit Bakterien, Viren, Pilzen oder Parasiten zurückzuführen. Neben möglichen Sekundärkomplikationen und Resistenzentwicklungen zählt zu den aktuellen Herausforderungen, dass durch klimatische Veränderungen auch tropische Erreger und Überträgerorganismen Einzug in unsere Breitengrade erhalten. Außerdem führen die immer größer werdenden Erkenntnisse über das Mikrobiom dazu, dass man sich zunehmend die Frage stellen muss, welche „Kollateralschäden“ man durch eine breite antibiotische Therapie tatsächlich in Kauf nehmen möchte.
Prof. Dr. Helmut Schöfer von der Klinik für Dermatologie der Uni Frankfurt stellte in seinem Vortrag wichtige Vertreter aller Infektionsarten vor. Wer glaubte, dass sich solche Erkrankungen nur oberflächlich auf der Haut abspielen, wurde schnell eines Besseren belehrt. Mögliche Sekundärkomplikationen und die Auswahl der zur Verfügung stehenden Therapieoptionen machen es nötig, die jeweiligen Erkrankungen wesentlich detaillierter und „tiefgreifender“ zu betrachten.
Bei der Impetigo contagiosa handelt es sich um eine hochinfektiöse bakterielle Hauterkrankung, die häufig bei Kindern und Neugeborenen auftritt. Es existieren eine großblasige Form (bullöse Impetigo) und eine kleinblasige Form, Verursacher in beiden Fällen ist ist vor allem Staphylococcus aureus, zum Teil auch Streptococcus pyogenes oder Mischinfektionen. Schöfer wies an mehreren Stellen seines Vortrages darauf hin, dass die Leitlinien zur Therapie von Staphylokokken- und Streptokokkeninfektionen seit mehr als fünf Jahren nicht mehr aktualisiert wurden. Außer für eine parenterale Therapie existiert eine aktualisierte S2-Leitlinie. Die durch β-hämolysierende Streptokokken oder Staphylococcus aureus verursachten begrenzten, eitrigen Phlegmonen werden Cephalosporine, wie Cefadroxil, Cefalexin oder Cefazolin, empfohlen; für schwere Verlaufsformen stehen parenterale Zubereitungen mit Cefuroxim und Flucloxacillin bereit, eventuell muss auch chirurgisch interveniert werden. Bei weniger als 5% der Patienten, die an der kleinblasigen Form der Impetigo contagiosa leiden, kann die Entzündungsreaktion auf die Nieren übergehen. Man spricht dann von einer Poststreptokokken-Glomerulonephritis. Man beobachtet eine endemische/familiäre Häufung, das Risiko ist bei Kleinkindern geringer als bei Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter. Die genetische Prädisposition ist Voraussetzung für eine Streptokokkentoxin-mediierte Immunreaktion, die zu massiven Hämaturien (Ausscheidung nicht zerfallener roter Blutkörperchen mit dem Urin), Ödemen, Hypertonie sowie Hypervolämie führen kann. Meistens heilt die akute postinfektiöse Glomerulonephritis folgenlos aus. Schweregrad und Dauer bleiben von der Behandlungsart der zugrunde liegenden Infektion – ob topisch oder systemisch – unbeeinflusst.
Wer C sagt, muss auch an B und D denken
Bei den Virushepatitiden hat sich in den letzten Jahren einiges getan: Gegen Hepatitis C existiert mittlerweile eine Reihe von Wirkstoffen, die für eine kurative Therapie eingesetzt werden können. Die Herausforderung sei es vielmehr, behandlungsbedürftige Patienten zu finden und im Kontext der Rabattverträge das günstigste Präparat auszuwählen. Ansonsten „seien eigentlich alle Probleme gelöst“, meint Prof. Dr. Eckart Schott, Chefarzt für Hepatologie am Helios Klinikum Emil von Behring in Berlin. Die Ansprechraten aller Regime und Genotypen läge mittlerweile über 95%. Die Kombinationen Sofosbusvir/Velpafasvir, Sofosbusvir/Velpafasvir/Voxilaprevir und Pibrentasvir/Glecaprevir könnten bei allen Patienten – unabhängig vom jeweiligen Genotyp – eingesetzt werden. Sofosbusvir/Velpafasvir/Voxilaprevir nur unter der Voraussetzung, dass die Patienten bereits mit direkten antiviralen Agenzien vorbehandelt wurden. Bei Vorliegen eines Genotypen 1b und 4 würde man Elbasvir/Grazoprevir bevorzugen, da es im Vergleich mit den Kombinationen für alle Genotypen günstiger sei.
Die sehr guten Heilungschancen der Hepatitis C führen zu einem Sinken der Neuerkrankungsraten in Deutschland – die Prävalenz liegt aktuell bei 0,6%. Vermehrt in den Fokus rücken daher die Hepatitis B und D, für die es bisher noch keine kurativen Therapieoptionen gibt. In der Reihe der Hepatitis-Viren (A bis E) sticht das wesentlich komplexer aufgebaute Hepatitis-B-Virus heraus, da es keine RNA, sondern DNA in sich trägt, die wesentlich stabiler ist und lebenslang im Wirtsgenom verbleibt. Allein aus gesundheitsökonomischen Gründen sei es ein wichtiges Ziel, die Virushepatitiden B und C zu heilen, weil damit rund 7,1 Millionen Todesfälle weltweit vermieden werden könnten. Die Behandlungskosten belaufen sich auf etwa 12 Milliarden Euro.
Gegen die Hepatitis B stehen derzeit zwei Therapiemöglichkeiten zu Verfügung – zum einen Nukleosid- bzw. Nukleotidanaloga wie Lamivudin, Adefovir, Entecavir, Telbivudin und Tenofovir, die zu einer Hemmung der Polymerase und Virusvermehrung führen. Zum anderen wird mit Interferon alpha versucht, das körpereigene Immunsystem zu aktivieren und gegen das Virus zu richten. In naher Zukunft soll es darüber hinaus weitere Optionen geben, vielversprechende Substanzen könnten small interfering RNA (siRNA) sowie Entry-Inhibitoren (Myrcludex B) sein. Für Myrcludex B wird eine Zulassung noch in diesem Jahr erwartet.
Der Magen – alles andere als „steril“
Priv.-Doz. Dr. Hans-Jörg Epple von der Charité Berlin nahm die Zuhörer mit auf eine Reise durch den Gastrointestinaltrakt – vom Mund ging es über Magen und Darm bis hin zum Enddarm. Als Vertreter der Klinik für Gastroenterologie und Infektiologie ist Epple prädestiniert dafür, die Zusammenhänge zwischen Magen-Darm-Beschwerden und Infektionen darzustellen. Diese Verbindung war viele Jahrhunderte unterschätzt worden, galt der saure Magen doch lange Zeit als „steril“. Epple zeigte anhand von Röntgenbildern und anderen bildgebenden Verfahren sowie Magen- und Darmspiegelungen, wie der menschliche Organismus Nahrung verdaut und gleichzeitig Krankheitserregern Tür und Tor öffnen kann. Nach dem Schluckvorgang wird das Essen schnell über die Speiseröhre in den Magen befördert. Daher sind Infektionen in der Speiseröhre eher selten. Ursachen einer Candida-Ösophagitis weisen deshalb in den meisten Fällen auf grundlegendere Erkrankungen hin. In Deutschland gilt HIV als eine der Hauptursachen, weltweit ist es die Tuberkulose. Während Candidosen in der Speiseröhre also durchaus auftreten können, sind sie im Magen so gut wie ausgeschlossen. Epple hat hierfür eine histologische Erklärung. So sei das Plattenepithel in der Speiseröhre wohl anfälliger als das Zylinderepithel des Magens.
50 Jahre Winterpharmacon – den Geburtstagskuchen ließen sich die mehr als 700 Teilnehmer im Kongresszentrum im österreichischen Schladming schmecken.
Dass im sauren Milieu des Magens durchaus bakterielle Organismen (über-)leben können, gilt heute als allgemein bekannt. Weltweit sind mehr als 50% aller Menschen mit Helicobacter pylori infiziert. Die Quote ist stark assoziiert mit dem sozioökonomischen Hintergrund – in Deutschland betrifft die Infektion jeden Dritten. Schon im Kindesalter findet der Erstkontakt statt, denn Erwachsene gelten als resistent. H. pylori persistiert dann ein Leben lang. Zytotoxische Effekte und Entzündungsreaktionen führen eigentlich in jedem Fall zu einer akuten Gastritis. 5% der Patienten entwickeln infolge der akuten Gastritis eine chronische Form mit Hyperazidität. Bei etwa 0,3% der chronisch leidenden Patienten kommt es zu einer Atrophie der Magenschleimhaut und in deren Folge zu einem Karzinom. Das relative Risiko für ein Karzinom erhöht sich durch eine Infektion mit H. pylori um den Faktor zwei bis acht. Eine weitere mögliche Folge in etwa 0,04% der Patienten ist die Entwicklung eines MALT-Lymphoms bedingt durch die chronische Antigenstimulation. Zudem leidet jeder fünfte Betroffene mit einer H.-pylori-Infektion an Reflux, dessen Pathomechanismus bisher ungeklärt ist. |











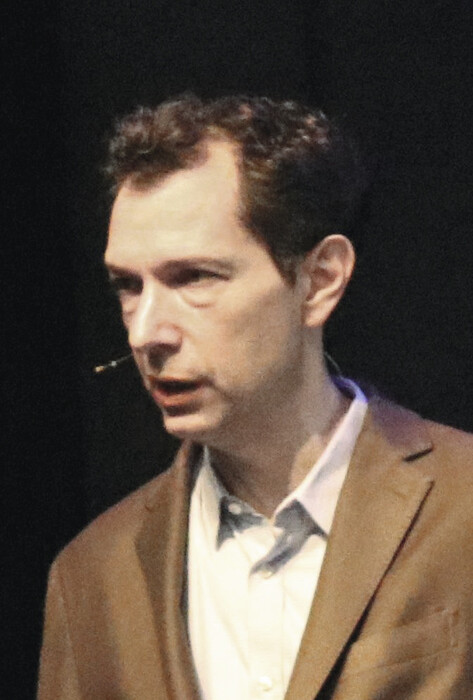























0 Kommentare
Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.